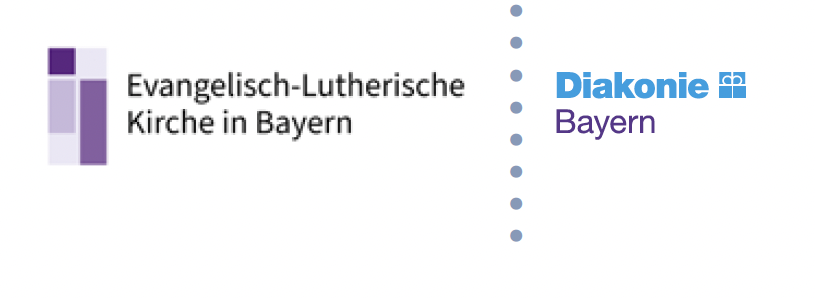Prof. Dr. Martin Arneth | Professor für Altes Testament
Evangelisch-Theologische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität MünchenHebräischlektor und Leiter der Geschäftsstelle Lehrstuhl Altes Testament II

Was macht den Psalm 23 zu einem guten Weggefährten in der Demenzbegleitung?
Der 23. Psalm ist momentan tatsächlich der wohl bekannteste Psalm. Seine Attraktivität beruht nicht nur auf der meisterhaften Übersetzung Martin Luthers, sondern hängt auch mit den eindrücklichen Bildern zusammen, mit denen der alttestamentliche Dichter aufwartet. Da ist ja nicht nur vom „guten Hirt“ die Rede, sondern auch vom „guten Wirt“, der den Tisch bereitet und voll einschenkt. Natürlich ist da vieles zeitgebunden. Hirten und ihre Kleinviehherden gehörten damals zum Alltag, und dass Gäste zu Beginn einer Feier vom Gastgeber vom Kopf abwärts mit wohlriechenden Ölen überschüttet wurden, war gewissermaßen Standard. Völlig fremd und unverständlich ist uns das heute aber nicht, und gerade die Verschränkung der unterschiedlichen Bilder lässt den Menschen, der den Psalm hört oder liest, meditierend zu durchgrübeln sucht oder andächtig innerlich nachvollzieht, vielleicht sogar zu seinem eigenen Bekenntnis und Gebet machen will, das eigentlich Gemeinte erahnen und fühlen.
Worum geht es dem Dichter denn im Kern?
Das Thema der Dichtung lässt sich vielleicht am besten mit „Vertrauen“ umreißen. Die Konzentration auf diesen Schwerpunkt ist innerhalb der Psalmen ungewöhnlich. Sonst tauchen Vertrauensbekundungen meist im Anschluss an eine Klage auf, etwa in Psalm 22, den der am Kreuz sterbende Jesus gebetet haben soll: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Ps 22,2). Psalm 23 aber spricht in vielen Facetten ausschließlich vom Vertrauen. Ich habe mich oft gefragt, ob die „Klage“ nicht das ehrlichere, authentischere Gebet ist. Denn meine Klage schreie ich ungefiltert heraus – auch gegenüber Gott. Vertrauen ist demgegenüber viel schwieriger, vielschichtiger und elementarer. Wir vertrauen meist nicht grundlos, entschließen uns vielleicht sogar dazu. Dann setzt Vertrauen immer eine gewisse Selbstbesinnung voraus. Wir unterstellen unserem Gegenüber, dem wir vertrauen, dass er ehrlich und zugewandt ist und unsere tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit nicht enttäuscht. Oftmals wird auch der Sinn- und Erfahrungshorizont viel weiter über die konkrete Situation hinaus ausgespannt, um das Vertrauen zu begründen. Grundsätzlich dürfte gelten: keine echte Beziehung kommt ohne Vertrauen aus, sonst handelt es sich um ein rein funktionales Verhältnis, bei dem wir nur Mittel zum Zweck sind. Überhaupt vertrauen zu können, ist aber andererseits in vielen Fällen auch unverfügbar wie ein Geschenk. Wer nur misstrauen kann, erlebt die Hölle.
Warum sagt denn der Dichter nicht direkt, worum es ihm geht?
Hätte er es bei einem einfachen Vertrauensappell belassen ‒ etwa: „Vertrau‘ auf ihn, er wird’s wohl machen“ ‒, dann wäre er dem Leben nicht gerecht geworden. Denn unser Leben ist vielfältig und vielspältig, es lässt sich nicht auf einen Begriff bringen oder nur mit einem Bild nachzeichnen. Wer sich auf sein Leben einen Reim machen will, erinnert sich nicht nur an die grünen Auen und den gedeckten Tisch, sondern eben auch an das finstere, vom Tod verschattete Tal, die Furcht vor dem Unglück und das „Angesicht der Feinde“. Das alles, eben auch die Brüche, Umbrüche und Abbrüche, gehört zu dem roten Faden dazu, den wir in unserem Leben zu entdecken hoffen, wenn wir zurückschauen und uns an die einzelnen Etappen erinnern.
Was ist eigentlich mit Gott? Von dem war bisher nur am Rande die Rede.
Da sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt. Die damaligen Hörerinnen und Hörer horchten wahrscheinlich schon bei dem einleitenden Bekenntnis auf: „Der Herr ist mein Hirte“. Es ist zwar im Alten Orient nicht sonderlich revolutionär, von Gott als einem Hirten zu sprechen. Das war üblich, auch im Alten Testament. Beim Propheten Jesaja etwa heißt es: „Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen“ (Jes 40,11). Aber wie jedermann aus dem Alltag wusste und wie es bei Jesaja auch direkt ausgesprochen wird: ein Hirte kümmert sich um die Herde. In Psalm 23 geht es demgegenüber um den Hirten und das einzelne Schaf. Darauf kommt alles an: nicht nur unser Leben verläuft individuell, nicht nur durch unseren Lebenslauf werden wir allererst zum Unikat, zu den einmaligen Individuen, die wir sind. Der Dichter kennt noch eine andere Vorstellung vom Individuum: Gottes Zuwendung macht uns zum unverwechselbaren, mit einem unendlichen Wert beseelten Menschen. Der Gottesvorstellung entsprechend folgen „Gutes und Barmherzigkeit“ lebenslang. Luther hat die hebräische Fassung, die in der letzten Zeile nur davon spricht, dass der Beter „alle Tage seines Lebens im Tempel Gottes bleiben wird“, vorsichtig durch ein einziges Wort entschränkt: „immerdar“ lässt jetzt die Ewigkeit der Gottesnähe durchscheinen.
Und noch etwas ist interessant: Die Kommunikation mit Gott verläuft keineswegs statisch. Zunächst wird in der Form eines Bekenntnisses über Gott geredet: „… er erquicket meine Seele“. Das drückt, bei aller Vertrautheit, eine gewisse Distanz aus. Dann aber intensiviert sich das Verhältnis von Einzelschaf und Hirte in dem Moment, da das finstere Tal ins Spiel kommt, zum Gebet „… denn du bist bei mir“. Die Existenz der Bedrohungslage wird dabei nicht einfach wegbehauptet, sondern im Bewusstsein tröstlicher Gottesnähe und tragfähiger Geborgenheit durchlebt.