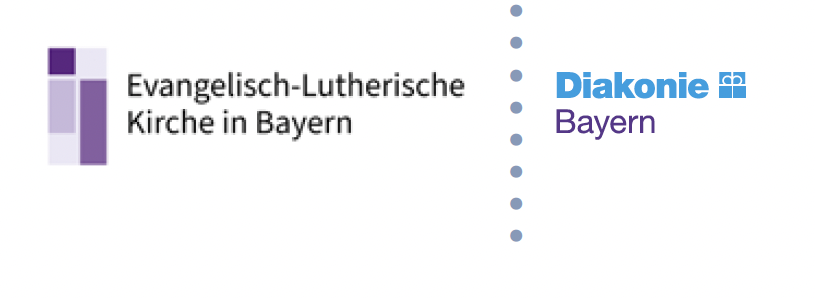Exemplarisch hier einige Gefühle:
Scham
Der Name einer Person, eines Ortes kann nicht erinnert werden. Worte fehlen. Was man mitteilen möchte, kann nicht ausgedrückt werden. Scham ist ein alltäglicher Begleiter und wird oftmals hinter Ausreden oder Notlügen verborgen. Zuweilen versuchen Menschen, jene Situationen zu vermeiden, die Scham auslösen. Es ist wichtig, um die Existenz und Bedeutung von Scham zu wissen.
Begegnung in Würde bedeutet, den Anspruch auf Intimität zu respektieren und das Recht des Gegenübers sicherzustellen, nicht jede Schwäche öffentlich machen zu müssen. Das beginnt bei der Unterstützung in der alltäglichen Körperhygiene und reicht bis zum Essen und Trinken.
Angst und Verzweiflung
Menschen, die in einer dementiellen Veränderung leben, spüren in Episoden, dass sie ihr Kurzzeitgedächtnis und dann nach und nach ihr Gedächtnis überhaupt verlieren.
Das macht Angst. Das lässt Menschen verzweifeln. Oftmals äußert sich diese Angst in „Pflichten“, die mit der Realität wenig zu tun haben, aber noch zu erledigen sind. "Ich muss noch kochen. Meine Eltern kommen zu Besuch. Ich muss jetzt unbedingt noch Geld abheben, um alles zu bezahlen!“. Es ist wichtig, die Angst ernst zu nehmen. Auf keinen Fall hilft es, Ängste ausreden zu wollen. Stattdessen gilt es, Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Zu versuchen zu verstehen, was Angst macht, oder auch Symbole gegen die Angst zu finden. Immer wieder gelingt es, etwas „von der Seele zu laufen“.
Aggression
Aggressive Gefühle sind unter demenzkranken Menschen häufig und haben verschiedene Ursachen. Aktueller Ärger über eine Bewohnerin oder einen Bewohner und alter Ärger vermischen sich. „Eine erste Quelle der Aggressivität ist die Krankheit selbst. Mit dem Schicksal der Erkrankung ,geschlagen’ zu sein kann dazu führen, dass Menschen aus Zorn um sich schlagen. Sie hadern mit dem, was ihnen widerfährt.“ (Das Herz wird nicht dement, S.53) Die Pflegenden, Freunde oder auch Fremde bekommen den Zorn zu spüren. „Es ist wichtig, das Hadern mit dem Schicksal und oft auch mit dem Sinn des weiteren Lebens zum Thema zu machen und anzusprechen.“ (S.54). Die Gefühle der Trauer über das, was nicht mehr geht und über das Loslassen-Müssen, haben Platz und ihre Rechte.
Aggressivität – zuweilen auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit
Dementiell Erkrankte fühlen sich hilflos und wissen nicht weiter; sie sind überfordert und fühlen sich so, als könnten sie „aus der Haut fahren“. Sie schlagen um sich. Eine Bewohnerin sagte in ihrer eigenen Aggressivität immer wieder: „Alle anderen sind böse. Sie schauen so böse. Sie nehmen uns alles weg.“ Dabei saß sie wie ein Häufchen Elend auf ihrem Stuhl und flüsterte leise. Immer wieder geht es darum, den Subtext zu entschlüsseln und so Entlastung im System zu schaffen.
Demenzsensible Seelsorge
Demenzsensible Seelsorge bedeutet, in die Welt des Gegenübers einzutauchen und Fetzen des Erinnerns, des Lebens wahrzunehmen. Wenn die Sprache abhandengekommen ist, sind es vielleicht Töne, Berührung oder Bewegung.
Zitat: Töne oder Berührung ersetzen abhandengekommene Sprache .Betroffene erinnern sich oft an Vertrautes aus längst vergangener Zeit. Sie haben Gedichte, Lieder, Gebete parat, selbst wenn sie nicht mehr sagen können, was es heute zum Mittagessen gab. Das gemeinsame Sprechen von Psalm 23 kann vielleicht die guten und positiven Empfindungen, die eine Person mit den Worten des Psalms verbindet, wieder erfahrbar machen. Ähnliches ist zu beobachten beim Sprechen des Vater Unser, beim Ritual des Bekreuzigens, bei den Einsetzungsworten zu Abendmahl oder Eucharistie. Zuweilen kann das Erinnern geweckt und verstärkt werden.
Begegnung mit An- und Zugehörigen
Der erkrankte Mensch ist nicht mehr derjenige, der er einmal war. Die Beziehung verändert sich rasant und die gemeinsame Lebenswelt zerbricht. Der dementiell veränderte Mensch ist immer weniger "erreichbar“, reagiert nicht und lässt die Angehörigen in Hilflosigkeit und mit Leere zurück. Die Belastungen im Alltag, in der Pflege oder bei Besuchen haben gewaltige Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände. Angehörige reagieren zuweilen aggressiv und vorwurfsvoll und erkennen die veränderte Realität nicht an. Das Abschiednehmen vom geliebten Menschen geschieht auf Raten. Und die scheinbare Vergeblichkeit der Beziehung und Begegnung lässt die An- und Zugehörigen einsam zurück. Es ist wichtig, Angehörigen Mut zuzusprechen, in der Beziehung zu bleiben, und sie daran zu erinnern: Das Herz wird nicht dement.
Zitat: „Das Herz wird nicht dement.“ – dieses Wissen kann Beziehungen lebbar erhalten.
Angehörige brauchen Orte, an denen sie Kraft und Trost, Unterstützung und Verständnis bekommen. Sie brauchen die Erlaubnis, an sich zu denken und für sich selbst zu sorgen, ganz im Sinne des Doppelgebotes der Liebe „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“.
Vielleicht hilft dieser Text Ihnen in Ihrem Bemühen, die Ihnen vertraute und doch fremd gewordene Person zu verstehen: „Das Gedächtnis des Körpers, der Sinne und das situative Gedächtnis, kurz das Gedächtnis des Herzens, bleiben lange bestehen und damit lange zugänglich. Der Zusammenhang zwischen Erinnern und der Beteiligung des Herzens war der Menschheit lange bekannt und selbstverständlich, bis er im Zeitalter der naturwissenschaftlichen Reduktion des Menschen auf Zellen und Moleküle in Vergessenheit geriet. Im Altertum meinte man, das Herz sei der Sitz des Gedächtnisses. Im Englischen heißt auswendig lernen: to learn by heart. Das Gedächtnis des Denkens kann schwinden, das Leibgedächtnis kann dennoch aktiv bleiben und aktiviert werden. Ja, mehr noch, das Leibgedächtnis kann Brücken zum Gedächtnis des Denkens bauen.“ (S.18)
Die Zitate stammen aus dem Buch: Udo Baer & Gabi Schotte-Lange: Das Herz wird nicht dement – Rat für Pflegende und Angehörige, 11. Auflage 2021, Verlag BELTZ, Weinheim, 125 Seiten