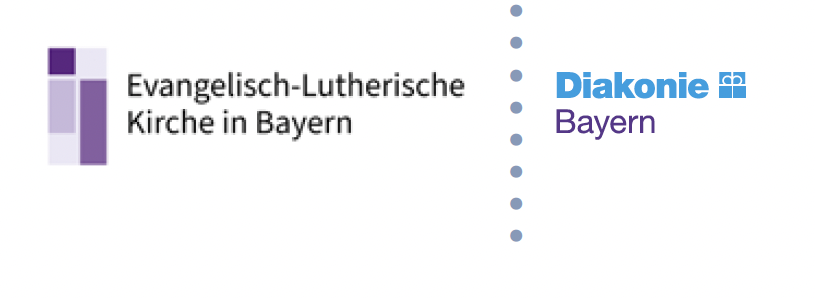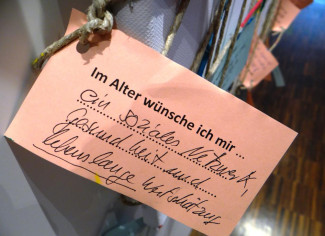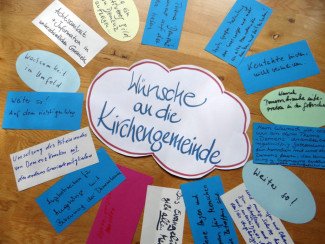Antje Koehler, Jg. 1976, Diplom-Heilpädagogin / Religions- und Gemeindepädagogin, war neun Jahre als evangelische Seelsorgerin in der Gerontopsychiatrie tätig, bevor sie für die Landesinitiative "Demenz-Service NRW" 2012 das Pilotprojekt „Dabei und mittendrin - Gaben und Aufgaben demenzsensibler Kirchengemeinden“ initiierte. Sie ist Autorin des Fachbuchs „Seelsorge und Predigt für Menschen mit Demenz“. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Indien lebt und arbeitet sie als Bildungsreferentin in Köln und begleitet verschiedene Zielgruppen innerhalb und außerhalb der Kirche in der Entwicklung und Festigung einer wertschätzenden Beziehungsgestaltung zu Menschen mit Demenz.

Demenz hat Zukunft. Alle 4 Sekunden wird weltweit neu die Diagnose Demenz gestellt. In Deutschland sind gegenwärtig bis zu 1,8 Millionen Menschen von einer Demenz betroffen. Diese Zahl wird sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen und hat umfassende Auswirkungen für die betroffenen Menschen, ihre Familien und die gesamte Gesellschaft.
Nicht nur die Kommunen und fachlichen Träger, sondern Vereine, Nachbarschaften und Kirchengemeinden stellt diese Entwicklung vor neue Herausforderungen, Aufgaben und Chancen. Da z.B. die Altersstruktur der ev. und kath. Kirchengemeinden in Deutschland der unserer Gesellschaft um bis zu 30 Jahre voraus ist, ist die gesellschaftliche Zukunft längst kirchliche Realität.
Auf ihren Seiten Demenzsensibel in Kirche und Gemeinde und Demenzsensible Kirchengemeinde beleuchtet Antje Koehler verschiedene Aspekte dieses Themas.
In einem Interview mit Raimar Kremer, Mitgestalter der umfangreichen Toolbox Demenz des Bistums Limburg, erklärt Antje Koehler anschaulich einen möglichen Weg zur demenzsensiblen Kirchengemeinde.
Wie kommt es, dass Sie sich seit Jahren für das Thema der demenzsensiblen Kirchengemeinde stark machen?
Alles begann 2012, als ich den einfachen Satz „Menschen mit Demenz, die gibt es in unserer Kirchengemeinde nicht“ hörte. Allein schon statistisch gesehen ist das sehr unwahrscheinlich. Denn es gibt in Deutschland etwa 1,8 Millionen an Demenz erkrankte Menschen. Ihre Dunkelziffer ist noch höher. Etwa zwei Drittel von ihnen werden zu Hause betreut. Sie leben also als ganz normale Gemeindemitglieder im direkten Wohn- und Lebensumfeld der Kirchengemeinden, werden dort aber häufig nicht bewusst wahrgenommen und tauchen im Alltag nur selten auf. Das hat mich neugierig gemacht, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
Was sind die Gründe für dieses Phänomen?
Viele demenzbetroffene Menschen ziehen sich klammheimlich aus dem Gemeindeleben zurück. Uns als Kirche gelingt dabei nicht automatisch besser, woran wir gesamtgesellschaftlich weiterhin scheitern. Wenn ich Menschen bei Vorträgen frage, wie oft sie in ihrem Alltag Menschen mit Demenz begegnen, zum Beispiel im Supermarkt, in der Straßenbahn, beim Bäcker, im Kino oder in der Kirche, dann erhalte ich am allermeisten die Antwort: „So gut wie nie.“
Haben Sie dafür eine Erklärung?
Scham und Angst gehören zu wesentlichen Symptomen dieser Erkrankung. Viele Betroffene haben Angst, in der Öffentlichkeit unangenehm aufzufallen. Und auch An- und Zugehörige berichten mir oft, dass sie z. B. nicht mehr wie früher in den Gottesdienst kommen, weil sie dort das Verhalten ihrer an Demenz erkrankten Angehörigen nicht kontrollieren können. Und in der Kirche aufzufallen sei für sie noch unangenehmer, als im Supermarkt. Wenn solche Rückzugstendenzen dann noch mit Ausgrenzungsmechanismen zusammenkommen, ist das fatal. Auch deshalb, weil die Betroffenen unter der Ausgrenzung und Isolation meist mehr leiden, als unter den Symptomen der Erkrankung.
Viele Betroffenen leiden unter der Ausgrenzung und Isolation meist mehr, als unter den Symptomen der Erkrankung!
Wieso sollten Kirchengemeinden Menschen mit Demenz ausgrenzen wollen? Was meinen Sie damit?
Ausgrenzung beginnt z.B. bei Veranstaltungsräumen, die nur über Treppenstufen erreichbar sind, bei schlechter Akustik, Veranstaltungen in denen zu lang und zu leise gesprochen wird und fehlenden Übertragungsanlagen; bei Kirchräumen, in denen die Toiletten nicht ausgeschildert sind und einer Gestaltung der Veranstaltungen, die im Schwerpunkt den Verstand statt alle Sinne anspricht. Zu solchen äußeren Barrieren kommen innere Barrieren, weil Menschen mit Demenz oft unterschwellig spüren, dass ihnen die Teilhabe im Alltag nicht mehr zugetraut wird.
Was können wir dagegen tun?
Oft geht es los mit Haltungsfragen. Eine Gemeinde muss sich fragen: Ist bei uns wirklich jeder und jede willkommen? Wie transportieren wir das? Wie gehen wir damit um, wenn ungewohnte Verhaltensweisen auftauchen, Menschen plötzlich im Gottesdienst herumlaufen oder jemand während einer Predigt laut den Satz sagt „Mir ist langweilig, ich will nach Hause!“
Was empfehlen Sie da?
Statt zu erstarren und so zu tun, als hätte niemand das Gesagte gehört, könnte der Prediger antworten: „Gut, dass Sie Bescheid geben. Ich bringe den Gedanken noch zu Ende und dann singen wir wieder ein Lied“. Im Besten Falle führt eine solche Situation vielleicht nicht nur zu einem Lacher und Lebendigkeit im Gottesdienst, sondern dazu, dass alle im anschließenden Kirchcafé darüber ins Gespräch kommen, wie wir die Gottesdienste erleben – und wer so etwas vielleicht noch denkt aber gelernt hat, dass es sich nicht gehört dies auszusprechen (lacht). Wir brauchen mehr Erlaubnisräume und einen menschenfreundlicheren Umgang mit ungewohnten Verhaltensweisen. Und einen Barrierenabbau, der meist zuerst in unseren Köpfen beginnt.
Gibt es weitere Ideen, was die Gemeinden tun können?
Unsicherheit und Angst vor den Begegnungen mit Menschen mir Demenz reduzieren sich am besten durch neue Erfahrungen. Wir müssen mit ihnen in Kontakt kommen, sie wahrnehmen und ernst nehmen, ihre Bedürfnisse berücksichtigen, sie aber nicht zur nächsten Problemzielgruppe der Kirchen erklären. Das ist durchaus ein schmaler Grat! Viele der Betroffenen wünschen sich weiterhin dazuzugehören – oder wie mir ein Mann mit Demenz neulich sagte „Ich möchte Mensch unter Menschen sein und bleiben. Sonst nichts“.
Eine Gemeinde hat dafür ins Vorbereitungsteam für das Gemeindefest ein von Demenz betroffenes Ehepaar geholt. Die Teilnehmer waren total erstaunt, dass der Mann mit Demenz selber sagen konnte, was er sich wünscht, was ihm Freude machen würde bei so einem Fest. Solche Erfahrungen sind wichtig und verändern Haltungen, die nicht nur am Sonntagmorgen sondern auch am Montag beim Bäcker oder Dienstag an der Bushaltestelle das Miteinander von Menschen mit und ohne Demenz erleichtern.
Welche Hilfsangebote brauchen die Menschen?
In unserem Verständnis geht es gar nicht darum, zusätzliche Angebote für die nächste Zielgruppe zu schaffen. Es geht um die Erweiterung von Teilhabemöglichkeiten, Akzeptanz von Vielfalt und Angebote für alle. Die Frage sollte sein: Wie können wir das, was wir sowieso anbieten, demenzsensibler und damit menschsensibler tun? Also so gestalten, dass Menschen mit einer Demenz sich gesehen und willkommen fühlen.
Zum Beispiel in demenzsensiblen Gottesdiensten für alle Sinne, die mit der ganzen Gemeinde gefeiert werden?
Ja, aber eben nicht nur da. Wir können die vorhandenen Besuchsdienste schulen und sensibilisieren. Statt eines speziellen Cafés für Menschen mit einer Demenz kann das Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst so gestaltet werden, dass Menschen mit Demenz sich dort willkommen fühlen. Oftmals helfen Sie gerne beim Eindecken und Abräumen oder erzählen von früher, wenn sie gefragt werden und merken, dass andere interessiert zuhören, Wenn wir Familiengottesdienste nicht nur mit jungen Eltern und ihren kleinen Kindern feiern, sondern den Begriff „Familie“ erweitern, so dass klar ist: Großeltern, gehören auch dazu. Neulich teilte eine Frau mit Demenz dabei mit ihrem Rollator stolz die Liedblätter aus und war bei „Großer Gott wir loben dich“ die tragende Stimme. Stellen Sie sich vor, wie gut es den Menschen tut, zu erleben, dass sie nicht nur Hilfeempfänger sind, sondern weiterhin etwas zu geben haben. Das gilt übrigens auch für Seniorennachmittage in der Gemeinde.
Inwiefern?
Menschen mit Demenz fühlen sich dort sicher, wenn sie wissen, dass sie von einer Art „Paten“ abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden. Wenn jemand unterstützend an ihrer Seite bleibt und die Verantwortlichen darauf achten, alle Sinne und nicht nur den Verstand anzusprechen. Die Erfahrung zeigt, dass Bewegung, Musik, Essen und kreative Elemente allen Teilnehmenden guttun. Und demenzbetroffene Gemeindeglieder dort oft weniger auffallen, als die meisten vorher befürchten, weil wir durch die Medien oft verzerrte Bilder einer weit fortgeschrittenen Erkrankung im Kopf haben und dabei ausblenden, dass der Anfang und das mittlere Stadium der Erkrankung oft viele Jahre andauern kann.
Menschen mit Demenz sind und bleiben Kirche. Nicht wegen, nicht trotz, sondern mit ihrer Demenz.
Sie sprechen davon, dass Menschen mit Demenz uns zu Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern werden können…
Vielleicht ist die wachsende Zahl von Menschen mit Demenz kein Zufall. Und genau das, was unsere Gesellschaft und Gemeinschaft am dringendsten braucht, um statt ‚höher, schneller, weiter‘ eher ‚langsamer, bewusster und menschlicher‘ zu werden. Sie erinnern uns an das, was wir meist verdrängen und vergessen: Wie verletzlich unser Leben ist. Und wie kostbar die Botschaft, von einem Gott geliebt zu werden, für dessen Liebe unsere Gedächtnisleistung unwichtig ist. Und der uns alle vor aller Leistung und trotz aller Einschränkungen annimmt, so wie wir sind. Insofern legen Menschen mit Demenz alleine in ihrem Sosein als Menschen den Finger in die Wunde eines Menschenbildes, indem wir viel zu oft meinen, uns über unsere Erfolge und Leistungen definieren zu müssen. Sie sind und bleiben Kirche, nicht wegen, nicht trotz sondern mit ihrer Demenz. Sich auf den Weg zu einer demenzsensibleren Kirche und Gemeinde zu machen, kann sich lohnen – für alle Seiten.
Danke an Antje Koehler für die Bilder zu diesem Artikel.
Interview von Raimar Kremer von der Website "Demenzsensible Gemeinde gestalten" des Bistums Limburg.